Beschluss der Landesdelegiertenkonferenz am 6.11.2021
Für die Zukunft brauchen wir starke Schulen, die unsere Kinder und Jugendlichen darin unterstützen, selbstständige, selbstbewusste und mündige Menschen zu werden. Dafür müssen sich auch unsere Schulen zu freien, offenen und sich stetig weiterentwickelnden Lernorten umgestalten.
Unseren Bildungseinrichtungen kommt bei der Vermittlung der freiheitlich-demokratischen Grundwerte unserer Gesellschaft eine besondere Rolle zu. Sie haben das Potential, große Teile der Gesellschaft zu erreichen.
Wer die Demokratie festigen möchte, kommt nicht umhin, auch die Schulen demokratisch zu gestalten. Dies wird umso deutlicher angesichts des Erstarkens rechtsradikaler, menschen- und demokratiefeindlicher Strömungen.
Von der Kita bis zum Schulabschluss kann und soll die Bildungs- und Erziehungsarbeit Radikalisierung, Rechtsextremismus und Autoritarismus vorbeugen. Demokratische Bildung ist mehr als ein Schulfach! Demokratische Bildung muss fest im gesamten System verankert sein: demokratische Gestaltung können junge Menschen nicht auswendig lernen, sondern sie kommt aus dem Erleben und Ausprobieren.
Gelingende demokratische Bildung stärkt die Schutzfaktoren gegen die falsche Sicherheit radikaler, geschlossener Weltbilder. Die Basis für gelingende demokratische Bildung bilden Zugehörigkeitsgefühl zur Gemeinschaft, Erfahrung der Selbstwirksamkeit, Empathie, Fähigkeit zur Perspektivübernahme und Selbstkontrolle. Für aktive Teilhabe an politischen und gesellschaftlichen Prozessen sind wertschätzendes, angstfreies Miteinander und eine friedliche Grundhaltung die Voraussetzungen. Wir wollen, dass junge Menschen Lust haben, unsere vielfältige, offene Gesellschaft auf der Basis unseres Grundgesetzes zu gestalten. Dafür brauchen sie politische Urteilsfähigkeit und die Fähigkeit, mit Quellen (Bild und Sprache) kritisch umzugehen, online genauso wie analog.
Damit diese Voraussetzungen für demokratische Bildung gelebt werden, braucht es in Schulen, Kitas, Berufsschulen tiefgreifende Änderungen: eine Teilhabe aller Beteiligten der Schulgemeinschaft an der Gestaltung des Schullebens.
Für die Entwicklung hin zu starken Schulen in der demokratischen Gesellschaft sehen wir drei Säulen:
- die Befähigung des Individuums zu demokratischem Handeln
- die demokratische Organisation der Schulgemeinschaft und
- die Selbstverantwortung der Schulen gegenüber dem Freistaat.
1. Die Befähigung aller Mitglieder der Schulgemeinschaft zu demokratischem Handeln und zur aktiven Teilhabe in der Gesellschaft
Für die Ausbildung demokratischer Mündigkeit braucht es einen sozialen Raum, der auf wertschätzendem Miteinander basiert und in dem sich alle angstfrei bewegen.
1.1. Gelebte Demokratie für Schüler*innen
Die aktive Teilnahme einer*s Schüler*in an der Schulgemeinschaft setzt Zugehörigkeitsgefühl, Wertschätzung und Angstfreiheit voraus. Schüler*innen müssen Selbstwirksamkeit und die Einbindung in die Gemeinschaft erleben.
Die aktive demokratische Partizipation der Schüler*innen entsteht durch eine gute Beziehung zwischen Lehrkraft und Schüler*in. Die Haltung der Lehrkräfte beruht auf einem demokratischen Wertekonsens und Erziehungsstil. Ziel ist neben dem Erwerb der Sachkompetenz die Unterstützung der Persönlichkeitsentfaltung und Stärkung der Sozialkompetenz. Demokratische Mitbestimmung beginnt dabei, dass Schüler*innen Lerninhalte, Lerntempo, Lernsettings und Lernorte mitgestalten können. Dies erfordert neue Formen der Partizipation für Schüler*innen.
Ebenso ist ein Aufbrechen der zeitlichen und räumlichen Grenzen des heutigen Schulalltags notwendig. Dabei bieten sich den Schulen vielfältige Möglichkeiten. (Siehe Punkt 2)
1.2. Lehrkräfte stärken
Eine zentrale Rolle bei der Schaffung eines demokratischen Lehr- und Lebensraumes Schule kommt der Lehrkraft zu. Daher muss zukünftig auf das Erlernen demokratischer Führungs- und Gestaltungskompetenzen in allen Phasen der Lehrkräfteausbildung, d.h. Studium, Referendariat und Fortbildung, der Fokus gelegt werden. Im Studium bedeutet dies eine deutliche Erhöhung der Praxiserfahrung und Etablierung einer kritischen Selbstreflexion. Politische Bildung und Demokratiepädagogik müssen fester Teil jedes Lehramtsstudiums sowie des Referendariats werden.
Außerdem muss das Lehrer*innenzimmer noch mehr die gesellschaftliche Vielfalt abbilden. Wir setzen uns ein für ein Förderprogramm für Diversität von Lehrkräften, welches bereits in der Studienberatung unter Berücksichtigung von Vielfaltsaspekten für den Lehrer*innenberuf wirbt.
Neben klassischen Fortbildungen im Bereich Politische Bildung und Demokratiepädagogik ist zukünftig ein Schwerpunkt auf Stützmechanismen für die Lehrkräfte zu legen. Professionelle Begleitung der Lehrkräfte und der Referendar*innen durch Supervision muss zur Norm werden und durch weitere Unterstützungsmaßnahmen, wie insbesondere kollegiale Beratung, aber auch gemeinsame Erarbeitung von Unterrichtsmaterialien und gemeinsames Wissensmanagement, ergänzt werden. Hierfür sind gezielt und ausreichend personelle, finanzielle und zeitliche Ressourcen zu schaffen, da nur so nachhaltig professionelle und demokratische Strukturen im Lehrberuf etabliert werden können.
1.3. Schulleitungen fördern
Eine Schule demokratisch und partizipatorisch weiterzuentwickeln, bedarf einer in diesen Bereichen hochkompetenten Schulleitung, da deren Führungsqualität das gesamte Schulklima und die Schulentwicklung bestimmt.
An bayerischen Schulen muss ein demokratischer Führungsstil die Norm werden.
Schulleitungen benötigen zur Bewältigung dieser Aufgaben profunde Kenntnisse über die Steuerung partizipativer Prozesse und die Gestaltung demokratischer Abläufe. Dafür ist es notwendig, schon frühzeitig potenzielle zukünftige Schulleiter*innen durch ein Personalentwicklungsprogramm gezielt in den nötigen Talenten zu fördern. Ein spezifisches und planvolles Fortbildungsprogramm zur demokratischen Führung in der Schulleitung sowie auch hier Mechanismen der Supervision und der kollegialen Beratung müssen feste Bestandteile der Schulleitungstätigkeit sein.
Außerdem sollen Mitwirkungsstrukturen, wie eine erweiterte Schulleitung oder punktuelle Mitarbeit, zukünftige Schulleiter*innen auf die Aufgaben und Anforderungen in der Schulleitung vorbereiten.
Zur gezielten Hinführung von Frauen an Führungspositionen in Schulen brauchen wir dringend ein Frauenförderprogramm.
1.4. Demokratische Kooperation mit den Eltern
Zur demokratischen, wertschätzenden Kultur der Schulgemeinschaft gehört auch, eine Kommunikation auf Augenhöhe zwischen Lehrkräften und Eltern zu etablieren.
Ebenso sollen die berufliche, kulturelle und sprachliche Vielfalt und Kompetenz der Eltern in den Schulalltag einbezogen werden. Die Eltern sollen in Zukunft mehr an den schulischen Gremien beteiligt sein. Längst überfällig ist die Einführung einer demokratisch gewählten, verfassten Elternvertretung auf Landesebene.
2. Demokratische Strukturen in Schulen neu organisieren
Schüler*innen müssen echte Selbstwirksamkeit erfahren. Bereits vereinzelt erprobte Formen und Gremien der Schüler*innenpartizipation sollen flächendeckend an allen bayerischen Schulen selbstverständlich werden.
Dies bedeutet eine deutliche Stärkung der SMV und Schaffung eines zeitlichen Rahmens zur Etablierung von Klassenräten und Schüler*innenparlamenten an allen Schulen. Diese Schüler*innengremien erhalten echte Entscheidungskompetenz im Schulalltag und einen eigenen Posten im Schulhaushalt. Somit können Schüler*innen wirklich ihre Schule mitgestalten.
Auch die Partizipationsmöglichkeiten und der Gestaltungsspielraum der Lehrkräfte muss gesteigert werden. Die Lehrer*innenkonferenz erhält Entscheidungskompetenzen bei elementaren Richtungsentscheidungen der Schulentwicklung, die die Lehrkräfte betreffen, sowie bei grundlegenden Budgetentscheidungen.
Zusätzlich erhält auch der Elternbeirat mehr Mitsprachemöglichkeit und eine wichtige Funktion in der Vernetzung der Schule mit den Vereinen und Organisationen im Umfeld der Schule.
Das Schulforum, in dem Vertreter*innen aller Beteiligter vertreten sind, wird zu einem echten Schulparlament mit weitreichenderen Entscheidungsbefugnissen weiterentwickelt. In diesem Gremium werden die Zielsetzungen der Schule schulöffentlich diskutiert, festgesetzt und evaluiert.
Die demokratisch geprägte Schule versteht sich als aktive Gestalterin ihrer Stadt bzw. Gemeinde und öffnet sich gezielt zum Austausch und zur Kooperation vor Ort.
Auch der Unterricht braucht mehr zeitliche Flexibilität und Gestaltungsspielräume. Schüler*innen erhalten mehr Autonomie und Zeit für die Entwicklung eigener Projekte, wie z.B. beim Modell des „Freiday“ (Initiative „Schule im Aufbruch“), bei dem ein Tag pro Woche für Zukunftsthemen zur Verfügung steht. Die Schüler*innen entscheiden selbst, was sie an diesen Tagen machen.
Für die zeitliche Autonomie ist die Ganztagsschule als Regel anzustreben. Für die Förderung der Teilhabe der Schüler*innen und die Einbindung aller in die Schulgemeinschaft müssen multiprofessionelle Teams an den Schulen etabliert werden.
3. Selbstverantwortung und Gestaltungsmöglichkeiten für die Schulen
Eine demokratische Schulkultur erfordert mehr Selbstverantwortung für die einzelne Schule. Eine moderne Schule ist eine lernende Organisation, die an einem stetigen Verbesserungsprozess arbeitet. Wir wollen die Entwicklung zu einer selbstverantworteten Schule mit eigenem Budget auf der Basis eines gemeinsam entwickelten Rahmens. Dieser Transformationsprozess bedeutet eine mehrjährige Schulentwicklung, die von externen Expert*innen begleitet werden muss. Ebenso ist die Vernetzung aller lokalen Bildungsinstitutionen zu regionalen Bildungslandschaften notwendig. Zur größeren Verantwortung gehört die Einführung eines Qualitätsmanagements und einer regelmäßigen, verlässlichen Evaluation auf Schulebene. Diese basiert auf einerbestärkenden Feedback-Kultur mit dem Ziel, schneller und zielgerichtet handeln zu können.
Als Sofortmaßnahme fordern wir die Umsetzung des existierenden „Gesamtkonzepts für die Politische Bildung an bayerischen Schulen“.
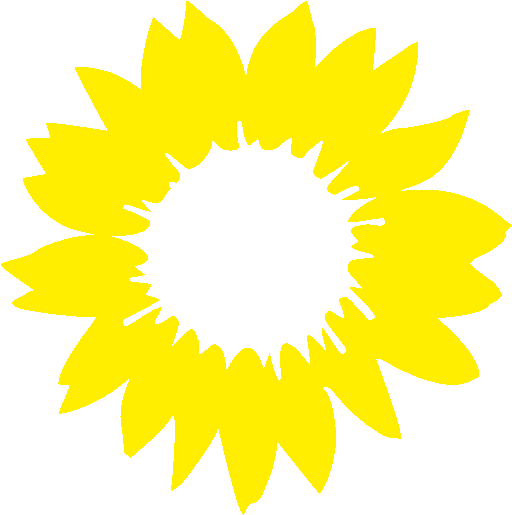



Neuste Artikel
Statement zur aktuellen Berichterstattung
Die Berichte der potenziell Betroffenen nehmen wir sehr ernst. Aus gutem Grund haben wir uns in der Partei Ombudsstrukturen gegeben – als vertrauliche und direkte Anlaufstelle für Betroffene. An vielen Stellen sind wir damit im politischen Raum Vorreiterin. Der Erfolg von Ombudsstrukturen hängt generell und entscheidend davon ab, dass sie vertraulich und anonymisiert stattfinden und…
Nachruf auf Alois Glück
Nachruf auf Alois Glück von der Landesvorsitzenden Gisela Sengl: Der Tod von Alois Glück ist ein herber Verlust für Bayern. Und ganz besonders für die CSU. Alois Glück war ein großer Sozialpolitiker, als Mitbegründer der Lebenshilfe war Inklusion für ihn nicht nur ein Wort, sondern ein wichtiger Auftrag. Hier hat er gerade in unserem Landkreis…
Politischer Aschermittwoch: A Mass statt Hass
Pressemitteilung Es war deftig, es war zünftig, es war brutal ehrlich: beim Politischen Aschermittwoch der GRÜNEN Bayern in Landshut. Die Zankhähne aus der Krach-Koalition, Markus Söder und Hubert Aiwanger, mussten einige Federn lassen. Denn Bayern braucht eine verantwortungsvolle Regierung und eine starke Stimme in Europa. v.l.n.r.: Eva Lettenbauer, Andrea Wörle, Omid Nouripour, Katharina Schulze, Gisela…
Ähnliche Artikel
Demokratie
Demokratie stärken und gegen Demokratiefeind*innen vorgehen
Beschluss auf der Landesdelegiertenkonferenz 2024 in Lindau Unsere Demokratie steht von vielen Seiten unter Druck – aus dem Ausland und aus dem Inland. Die Bedrohung für unsere freiheitliche, demokratische Grundordnung und den gesellschaftlichen Zusammenhalt wächst. Der Rechtsrutsch in unserem Land nimmt an Fahrt auf. Die Anzahl antisemitischer Vorfälle hat sich stark erhöht. Die neuesten Veröffentlichungen…
Demokratie
Auf Kuschelkurs mit Autokraten – wie die CSU unsere Demokratie riskiert
Pressemitteilung Unsere Demokratie und unsere freie Gesellschaft sind unter Beschuss. Sie müssen jeden Tag aufs Neue verteidigt werden. Wir GRÜNE stehen dafür mit jeder Faser unserer Herzen. Wir setzen uns für unsere Demokratie ein. Die CSU allerdings trifft sich mit Gegnern der Meinungsfreiheit, Gegnern Europas, Gegnern von Vielfalt und Toleranz. Exemplarisch zeigt das gerade Andreas…
Demokratie
Erinnern – Unser Auftrag Demokratie braucht Erinnerung
Beschluss der Landesdelegiertenkonferenz am 24.09.2022 Mehr als 70 Jahre nach der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft, den Gräueltaten der Nazi, gibt es immer weniger Zeitzeug*innen, die unmittelbar über ihre schrecklichen Erlebnisse, ihr Schicksal und das Schicksal ihrer Angehörigen und Freunde berichten können. Wir sind aufgefordert, mit dem Wissen um die Vergangenheit tragfähige Konzepte der Erinnerung für die Zukunft…